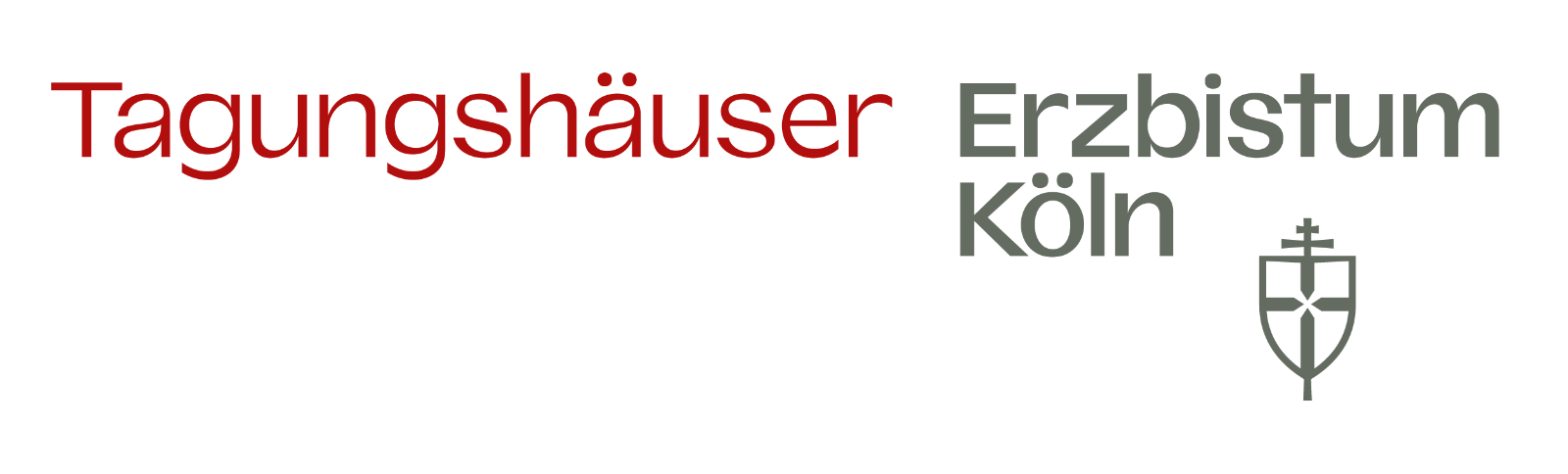Historie des KSI:September 1945: Die Geburt einer Idee

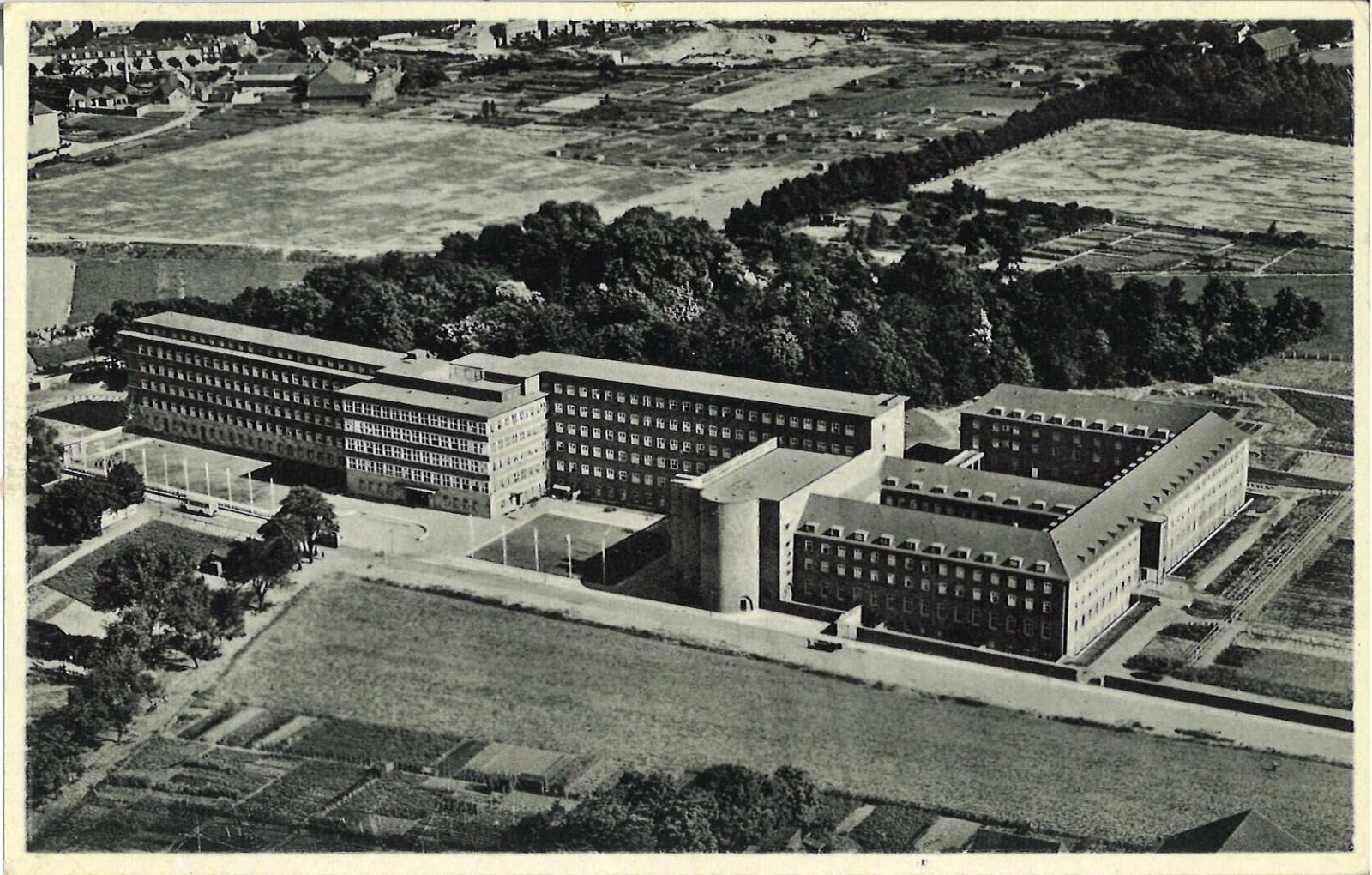
von André Schröder
Auch wenn das 80-jährige Bestehen des KSI erst 2027 gefeiert wird, entstand die Idee bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Am 29. September 1945 schrieb Hermann Joseph Schmitt im Krankenhaus Köln-Hohenlind einen Brief an Erzbischof Josef Frings. Darin überreichte er den „Plantentwurf eines im Kettelerhaus zu errichtenden Katholisch-sozialen Instituts“. Professor Oswald von Nell-Breuning hatte den Entwurf bereits weitgehend gebilligt.
Obwohl das KSI später nicht im kriegszerstörten Kettelerhaus, sondern im ehemaligen Priesterseminar in Bad Honnef untergebracht wurde, war Schmitts Konzept visionär – vor allem, da es kein Vorbild für ein solches Institut gab. Schmitt erkannte im westdeutschen Raum, besonders im Rheinischen Revier, einen sozialen Brennpunkt, an dem Industrie, Landwirtschaft und Handel aufeinandertrafen. Diese Mischung führte zu dauerhaften Spannungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Während des Nationalsozialismus wurden diese Differenzen durch Repression unterdrückt, nicht gelöst. Die katholische Soziallehre war verfemt, der politisch engagierte Katholizismus unterdrückt worden. Nun, nach dem Krieg, sah Schmitt die Zeit gekommen, die Soziallehre wiederzubeleben und in die Gesellschaft zu tragen.
Das KSI sollte nicht nur regional wirken, sondern über nationale Grenzen hinweg Brücken bauen und das nur wenige Monate nach Ende des Krieges! Das Kettelerhaus erschien ihm dafür symbolisch geeignet: Hier wirkten Persönlichkeiten des katholischen Widerstands wie Otto Müller, Nikolaus Groß und Bernhard Letterhaus.
Auch das vorgesehene Lehrpersonal war bezeichnend: Oswald von Nell-Breuning, Theodor Steinbüchel, Alois Dempf, Hans Berger, Franz Mariaux, Eberhard Welty – viele von ihnen hatten sich gegen das NS-Regime gestellt. Auch Hermann Mosler, Gutachter bei den Nürnberger Prozessen, und der von den Nazis mit Publikationsverbot belegte Heinrich Lützeler waren vorgesehen. Ungewöhnlich erscheint dagegen Wilhelm Herschel, ein angesehener Arbeitsrechtler, der jedoch NS-Organisationen angehörte. Seine Berufung könnte beispielhaft für das Dilemma der Nachkriegszeit stehen: Der Nationalsozialismus war so tief verankert, dass der Bruch mit ihm oft nur unvollständig gelang.
Schmitts Vision für das KSI: dem Rückzug der Kirche aus dem öffentlichen Leben entgegenwirken. Mit Hilfe der Katholischen Soziallehre, die durch guten Willen verwirklicht, zur wahren Wohlfahrt der Völker beiträgt, könne das Vorhaben gelingen.