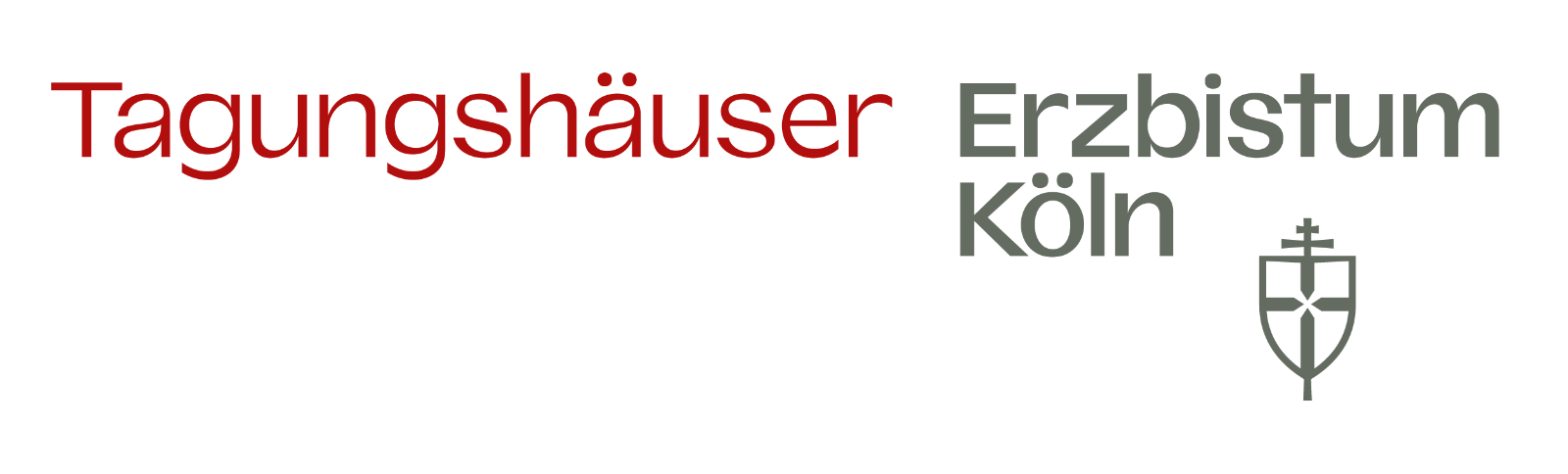Kathedralen digitaler Kunstschau:Ästhetische Erfahrungen der Transzendenz in digitalen Kunstzentren

von Prof. Birgit Mersmann
Digitale immersive Kunstausstellungen stellen ein neuartiges, massenaffines und kapitalstarkes globales Kunstphänomen in der Ära des digitalmodernen Spektakels dar, wie es etwa der weltweite Markterfolg der Imagine Van Gogh-Ausstellung (seit 2008) belegt. Sie spiegeln die Neupositionierung, Aktualisierung und Reauratisierung der Kunstgeschichte im Zeitalter des digitalen Bildes wider, ebenso das Bedürfnis nach individueller wie gemeinschaftlicher Transzendenzerfahrung durch virtuelle Bildimmersion. Vertreter*innen der Kunstgeschichte und Kunstkritik haben harsche Kritik an den digital-immersiven Kunstschauen geäußert, sie werfen ihrem Ausstellungs- und Geschäftsmodell die kommerzielle Entwertung und digitale Verflachung von Meisterwerken der Kunst, kunstgeschichtlicher Vermittlung und Kunsterfahrung vor und stellen (wie schon so oft und vergeblich in der Geschichte der Kunst) die Frage nach dem „Ende der Kunst“ in den Raum. Vom Standpunkt der Hochkultur aus betrachtet erscheint diese Kritik durchaus verständlich und gerechtfertigt; jedoch verkennt sie, dass es sich um ein populärkulturelles Kunst(ausstellungs)phänomen handelt, das in einem breiteren bildkulturellen Kontext an der Schnittstelle zwischen Digital-, Unterhaltungs- und Fankultur, Kreativ- und Kulturerbeindustrie sowie Tourismuswirtschaft entstanden ist und eine neues digital-immersives Kunsterleben mit ästhetischer Transzendenzfahrung jenseits der klassischen Kunstmuseen und -ausstellungen ermöglicht.
Die 2018 in Paris gegründeten Ateliers des Lumières sind einer der globalen Player in diesem Kunstschaugeschäft, sie inszenieren in multimedial opulenten Digitalbildprojektionen an historisch bedeutsamen Industrie- und Erinnerungsorten die großen Meisterwerke der (meist modernen) Kunstgeschichte, darunter Van Gogh, Klimt, Rousseau, Picasso etc. Die Idee eines immersiven Kunstbildspektakels, wie es die Ateliers des Lumières zu einer eigenen erfolgreichen Marke entwickelt haben, geht zurück auf den französischen Fotografen und Filmemacher Albert Plécy. Im Steinbruch von Les Baux-de-Provence in Frankreich projizierte er 1977 auf einer Ausstellungsfläche von 4000m2 das erste immersive Cave-Spektakel der Kunst – damals noch vordigital. Das szenografische Environmentkonzept dieses audiovisuellen Kunstspektakels wurde von ihm Bilderkathedrale getauft, da es in nur 100 Sekunden eine Kunstsynthese herzustellen vermochte, für welche die Erbauer von Kathedralen Jahrhunderte gebraucht hätten. In der immersiven Bilderkathedrale sah er die Zukunft der Wagnerschen Idee des Gesamtkunstwerks realisiert.
Die Schauräume digitalimmersiver Kunstausstellungen offenbaren ein gesamtkunstwerkliches Transzendenzerleben. Wie Kathedralen und Kirchen als Orte der Daseinserweiterung wirken, so erzeugen digitalimmersive Ausstellungsorte durch die Entgrenzung von Kunstbildern und deren Neukomposition zu einem Gesamtkunstwerk eine sakralisierte Atmosphäre ästhetisch-sinnlicher Wahrnehmungs- und Selbstüberschreitung. In der dynamisch-fluiden Lichtmetaphysik des digital projizierten, raumfüllenden Bildes vergegenwärtigen sie ein immaterielles, spirituelles (Kunst-)Versprechen.
Über das Projekt „Digitales Kuratieren“
Der Lehrstuhl für Zeitgenössische Kunst und digitale Bildkulturen von Prof. Dr. Birgit Mersmann ist Kooperationspartner des Katholisch-Sozialen Instituts im Projekt „Digitales Kuratieren“.
Das Projekt führt Studierende der Kunstgeschichte und Kunstvermittler/innen in Kirchengemeinden in die Theorie und Praxis des digitalen Kuratierens ein und ermöglicht ihnen, Erfahrungen mit 3D-Technologien und kuratorischer Software zu sammeln.
Das Projekt wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW durch den Innovationsfonds für Weiterbildung gefördert.